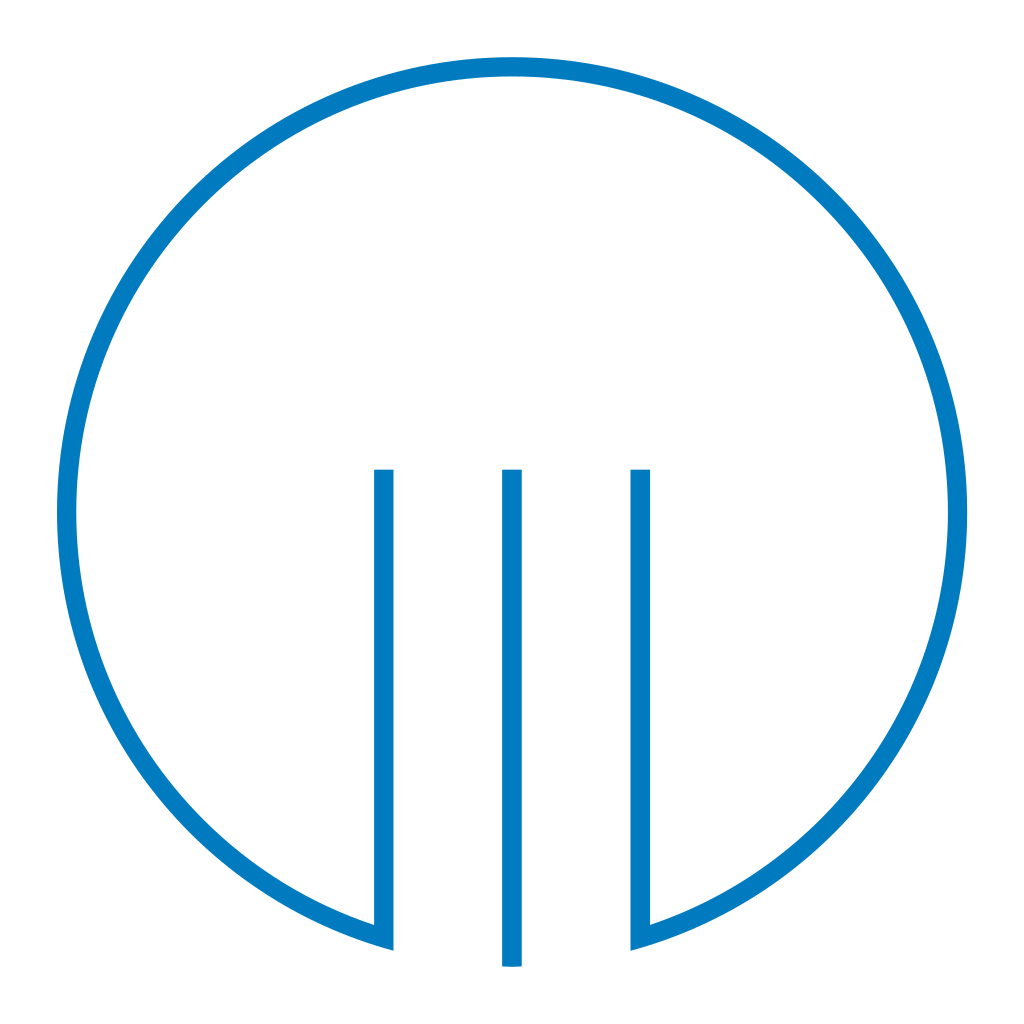I. Definition
Aufgrund der starken Bedeutung des Wortes Souveränität und den nicht erfüllbaren Anforderungen, die eine solche mit sich bringen würde, verzichtet das BayDiG auf die Verwendung dieses Begriffes und spricht selbst von „digitaler Handlungsfähigkeit“.1 Der Begriff „digitale Souveränität“ hingegen wird überwiegend in der Begründung genannt und ist dort definiert als „Grundlage und Voraussetzung für die aktive Gestaltung der Digitalisierung durch den Freistaat Bayern ist die Gewährleistung einer möglichst umfassenden autonomen digitalen Handlungsfähigkeit“. Technisch versteht man unter digitaler Souveränität eine weitgehende Unabhängigkeit von bestimmten Lösungen, so dass man unabhängig entscheiden kann, welche Technologien man einsetzt, sei es Software- oder Hardwareseitig.2 Das Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik beschränkt sich hingegen in seiner Definition auf die „Selbstbestimmung hinsichtlich des Wirtschaftsguts Daten“3, was aber zu eng gefasst ist, denn Neben der Datensouveränität ist auch die technologische Souveränität Bestandteil der digitalen Souveränität.
II. Umsetzung des Begriffs
Um eine vollständige digitale Souveränität im technischen Sinne zu erreichen müssten der Staat die Kontrolle über alle Bereiche innehaben, die im weitestgehenden Sinn mit digitaler Technik zu tun haben. Also von der Internetleitung, über die Rechnerarchitektur, die Betriebssysteme und Anwendungsprogramme, sowie in der Fertigung. Das kann wegen der Komplexität, die die Technik heutzutage angenommen hat, kein Staat mehr leisten. Vielmehr geht es also darum, eine Unabhängigkeit zu wahren, um noch selbst entscheiden zu können welche Programme und Betriebssysteme man einsetzen möchte. Nach dem aktuellen Stand ist Bayern noch nicht digital souverän, denn viele Programme, die die kommunalen Verwaltungen benötigen, laufen nur unter dem Betriebssystem Windows. Auch im Bereich der elektronischen Aktenführung könnte man in eine Abhängigkeit geraten, wenn man nicht aufpasst, dass die Datenbestände in alternative Produkte importiert werden können, ohne die Wesentlichen Informationen zu Zugriffen, Bearbeitungen und Anmerkungen zu verlieren. Der Freistaat wäre also aufgefordert, unter anderem Speicherformate zu identifizieren und zu standardisieren, damit Programme für bestimmte Aufgaben auch ersetzt werden können. Dies mag im ersten Moment Kosten verursachen, spart aber auf lange Sicht sehr viel mehr Geld ein, denn es müssen keine teuren Konvertierungen durchgeführt werden und die Anbieter können nicht so leicht Profit aus der Abhängigkeit schlagen, da die Wechselkosten niedrig sind. In Teilen gibt es bestimmte Standards bereits, denn für die Umsetzung des OZG (Zugriff auf Verwaltungsleistungen über ein Portalverbund) muss eine Interoperabilität zwischen den Programmen in den Verwaltungen vorhanden sein.4 Die Stadt München hat vor einigen Jahren bereits einen Versuch unternommen, ihre digitale Souveränität auszubauen und tausende Arbeitsplätze der Verwaltung mit Linux zu betrieben. Dieser Versuch wurde bald darauf wieder eingestellt, da man es nicht schaffte, die Mitarbeiter für die Nutzung zu begeistern und viele sich vor allem aus Gewohnheit zur altbewährten Windows- Umgebung zurücksehnten. Nach dieser Rolle rückwärts, wurde im Jahr 2020 wieder beschlossen, dass man ab 2021 wieder präferiert Open-Source-Software einsetzen möchte.5 6 Ein solcher Zick-Zack-Kurs ist nicht zielführend, zumal viele Gegenargumente wohl unter dem Einfluss kommerzieller Anbieter wie Microsoft und HP (als Microsoft-Partnerunternehmen) standen. Auch die Verlegung der Microsoft-Deutschland-Zentrale in diesem Zusammenhang7 hat ein Geschmäckle, denn es geht um nicht unerhebliche Summen an Gewerbesteuer. In einer idealen Welt mit größtmöglicher digitaler Souveränität des Staates würde er komplett auf eigenentwickelte Programme zum erledigen von Verwaltungsaufgaben zurückgreifen und diese auf einem quelloffenen (oder selbst entwickelten) Betriebssystem laufen lassen. Nordkorea verfolgt schon länger einen solchen Ansatz, wenngleich die Motive in diesem Fall andere sind.89 Mit dem Trend immer mehr Anwendungen in die Cloud zu verlagern, steigt das Bedürfnis, staatliche Rechenzentren aufzubauen, so dass die Kontrolle und Verantwortung über den Betrieb nicht im Bereich von privaten Unternehmen liegt. Auf Bundesebene erwägt man derzeit, eine Bundescloud auf der Basis von Microsoft-Produkten aufzubauen10, was nicht im Sinne einer digitalen Souveränität ist, Bayern sollte also zur Erfüllung des Ziels aus Art. 3 BayDiG dagegen protestieren.
III. Chancen und Herausforderungen
Eine große Herausforderung in der (Zurück-)Erlangung der digitalen Souveränität ist es, die in der Vergangenheit entstandenen Abhängigkeiten wieder aufzulösen. Konkret bedeutet das, dass man alle Stellen, die fremde nicht-quelloffene Software verwenden ausfindig macht und diese dann entweder durch freie Software ersetzt oder eigene Programme entwickeln lässt. Vernachlässigt man dies, so entsteht das Risiko, dass entweder im Falle einer Firmeninsolvenz des Anbieters (bzw. einer sonstigen Einstellung des Produktes) Schwierigkeiten auftreten oder mit der Zeit immer höhere Lizenzgebühren gefordert werden. Vom Staat entwickelte Programme sollten dann, soweit keine Sicherheitsaspekte dagegen sprechen, open source sein, getreu dem Motto „public money, public code“. Sicherheitslücken können auf diese Weise leichter geschlossen werden, denn je mehr Menschen den Quellcode ansehen können, desto eher kann eine Lücke ausfindig gemacht und behoben werden11. Zwar gibt es auch Kritik an einer solchen Haltung, aber die lässt sich vor allem auf kleine Open-Source Projekte beziehen, welche nur wenige Nutzer haben. Im Fall der Verwaltungsprogramme dürfte ein großes Interesse in der Community vorhanden sein. Ein echtes Erfolgsbeispiel für eine solche Entwicklung ist die Corona-Warn-App Deutschlands, welche von vielen Anregungen und Beiträgen von Privatleuten verbessert wurde.12 Der konsequente Einsatz eigener Programme für die Verwaltung bietet die Chance, jedes Jahr eine große Menge Geld für Lizenzgebühren einzusparen. Allein für die Stadt München handelt es sich hierbei um zweistellige Millionenbeträge.13 Kleine Kommunen könnten so ein Projekt hingegen nicht auf die Beine stemmen, denn sie verfügen weder über die finanziellen, noch über die personellen Ressourcen. Durch eine Zusammenarbeit auf bayrischer Ebene könnte ein Software-Ökosystem geschaffen werden, aus dem sich die Kommunen ihre benötigten Bausteine herauspicken können. Das wäre auch kein Widerspruch zur kommunalen Selbstverwaltungsgarantie, da man ja nur verschiedene Möglichkeiten anbietet, ähnlich wie es bei der Bedarfsbündelung durch die FITKO heute schon geschieht. Neben der Auswahl der eingesetzten Software kann eine digitale Souveränität auch bedeuten, dass man die Kontrolle über verwendete Netze hat, also dass das Telekommunikationsnetz nicht von privaten Anbietern betrieben und ausgebaut wird, sondern von staatlicher Seite. Dies hat dann den Vorteil, dass der Ausbau schnellerer Anschlüsse sich nicht nur auf Ballungsräume beschränkt, sondern auch ländliche Regionen gut verbunden sind. Gerade wenn man flächendeckend Verwaltungsleistungen online anbieten möchte, müssen die Bürger auch die Möglichkeit haben, die Seiten mit guter Geschwindigkeit aufzurufen. Für die Kommunen entsteht außerdem noch der Vorteil, dass eigene Netze eine Investition darstellen, für welche sie regelmäßig Nutzungsentgelte von den Internetanbietern bekommen.
IV. Fazit und Bewertung
Die digitale Souveränität sollte eine wichtige Anforderung bei der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung sein, hat aber auch eine Bedeutung im Gesamtkontext der Digitalisierung der gesamten Gesellschaft. Meines Erachtens fehlen noch weitere Konkretisierungen, welche Maßnahmen zu mehr digitaler Souveränität führen sollen. Bisher ist überwiegend der Betrieb eigener Rechenzentren erwähnt, welcher sich auf der GAIA-X-Initiative der EU stützt. Zurückzuführen ist dies wahrscheinlich auf einer Fehlinterpretation von „digitaler Souveränität“, indem man sie mit Datensouveränität gleichsetzt und das Ziel damit schon erreicht sieht. Gesetzgeberisch könnten Anforderungen wie Interoperabilität von Verwaltungsprogrammen, die Bevorzugung von Open-Source-Programmen und der Leitsatz „public money, public code“ festgeschrieben werden. Neben diesen Punkten, die die Verwaltung unmittelbar betreffen, sollte außerdem der Netzausbau, sowohl beim Breitband-, als auch beim Mobilfunknetz vorangebracht werden, indem man Kommunen bei der Errichtung unterstützt und bürokratische Hürden reduziert, so dass die Genehmigungsverfahren schneller ablaufen können. So können abgelegenere Orte, welche aus Perspektive der großen Telekommunikationsanbieter unrentabel sind, an der Digitalisierung partizipieren. Denn ein Recht auf elektronische Verwaltung ohne Internet im Dorf bringt dem Bürger nichts. Mit dem aktuellen Kurs entsteht ein großes Gefälle zwischen den Städten, in denen mittlerweile 5G-Netze errichtet werden und dem ländlichen Raum, in dem teilweise gar kein Empfang vorhanden ist. Seit der Abschaltung der 3G-Netze14 gibt es außer LTE nur noch das sehr langsame GSM-Netz, mit welchem sich nicht brauchbar im Internet surfen lässt. Durch die Gründung einer staatlichen Firma zur Entwicklung von Softwarelösungen könnte man die Nachfrage bündeln und Kosten für individuelle Entwicklungen verhindern. Dies stärkt vor allem kleinere Kommunen, denn die meisten Beratungsunternehmen sind auf Microsoft-Produkte spezialisiert und so stehen derzeit gar nicht die Kapazitäten für Open-Source-Implementierungen zur Verfügung. Die Stadt München hat über ihr IT-Referat bereits solche Eigenbetriebe zur Beratung und Implementierung aufgebaut.15