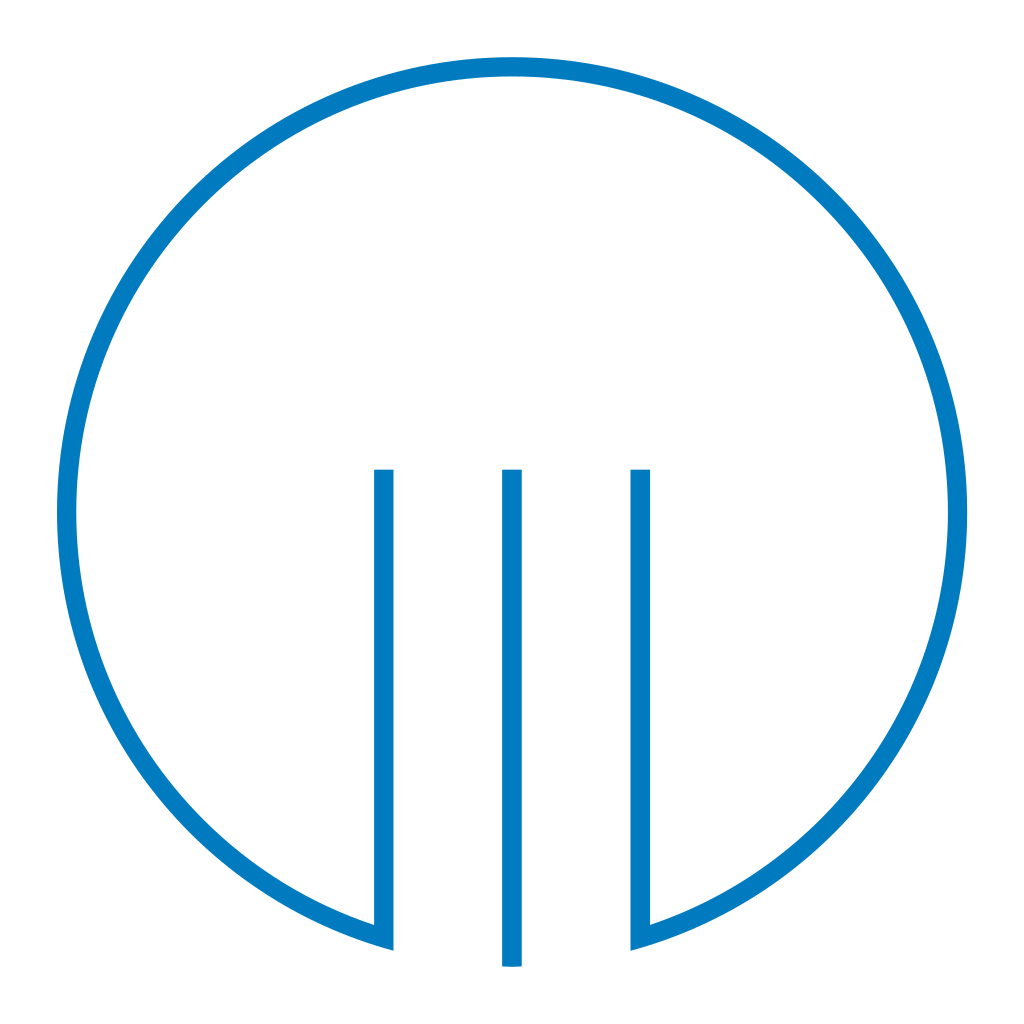I. Definition
Im Rahmen der Förderung der Digitalisierung, mit der sich Art. 2 des Bayrischen Digitalgesetzes beschäftigt, wird unter Nr. 8 der „digitale Verbraucherschutz“ erwähnt. Es handelt sich dabei nicht um eine formelle Definition, jedoch sind in der Norm selbst, wie auch in der zugehörigen Begründung noch die Stärkung der digitalen Kompetenzen der Verbraucher genannt. Weiter betont die Begründung, dass aufgrund der besonderen Situation im Digitalmarkt (wenige sehr große und mächtige Anbieter), Nachteile für Verbraucher entstehen könnten. Ähnlich kann man es auch aus der Wirtschaftsinformatik betrachten, denn durch die de facto Monopole in verschiedenen Bereichen, haben die Anbieter eine große Macht über das Verhalten der Kunden, welches sie zudem über psychologische Tricks steuern können. Viele Verbraucher kennen keine Alternativen für bestimmte Dienste, so dass sich beispielsweise das Wort „googeln“ für die Suche im Internet in der deutschen Sprache durchgesetzt hat.1
II. Umsetzung des Begriffs
Um den Verbraucherschutz im digitalen Raum zu verbessern bestehen im wesentlichen zwei Möglichkeiten: 1. Aufklärung der Verbraucher und 2. rechtliche Schranken für die Anbieter. Die Aufklärung der Verbraucher kann man in verschiedene Stufen einteilen, welche sich nach dem Entwicklungsstand richtet. Dies stützt sich im wesentlichen auf einfache psychologische Erkenntnisse. Eine mögliche Abstufung könnte wie folgt aussehen: 1. Kinder: Erstkontakt, 2. Jugendliche (~ ab der Oberstufe): intensivste Nutzung für die Schule und im privaten und 3. Erwachsene: private und ggf. berufliche Nutzung. Weil Menschen Gewohnheitstiere sind2, nutzen sie zumeist die Lösungen, die sie zuerst kennengelernt haben. Oftmals besteht auch kein Grund, sich eine andere Lösung anzueignen. Hat man trotzdem verschiedene Möglichkeiten kennengelernt, so nutzt instinktiv die scheinbar bequemste. Aktuell sieht es insbesondere in den Schulen so aus, dass Ort überwiegend Windows-Computer vorzufinden sind, auf denen die Schüler dann ihre Texte in Microsoft-Office anfertigen sollen und im Browser auch Google die Standard-Suchmaschine eingestellt ist. Folglich werden die Schüler praktisch vom Erstkontakt mit Computern an diese Produkte gewöhnt, was zu Zeiten des klassischen Software-Marktes dazu geführt hat, dass Familien für die wenigen Schulaufgaben, die am Computer anzufertigen waren, teuere Microsoft-Office-Lizenzen gekauft haben. Diese Gewohnheitsmonopole kann man mitunter dadurch bekämpfen, indem man den Kindern schon in der Schule die Benutzung anderer Programme ermöglicht, als Betriebssystem also zum Beispiel eine Linux-Distribution einsetzt. Daneben sollte auch der Einsatz von freien Office-Paketen erwogen werden. Dies hat nicht nur Vorteile für die Kompetenzen der zukünftigen Verbraucher, sondern entlastet auch die öffentlichen Haushalte. Jedes Jahr wird viel Geld für die Lizenzen ausgeben, obwohl sie schon großzügige Rabatte bekommen, denn die Anbieter wissen genau, dass die einmal gewöhnten Verbraucher meist bei ihrem Produkt bleiben werden. Auch die voreingestellte Suchmaschine auf Schulcomputern müsste nicht unbedingt Google lauten. Weil diese aber überall voreingestellt sind und die Kinder diese schon aus der Schule gewohnt sind, werden sie auch im privaten Umfeld immer verwendet. Auch muss vermittelt werden, dass man für bestimmte Dienste, auch wenn diese kostenlos erscheinen, doch mit seinen persönlichen Daten bezahlt. Dies mag für viele Kinder harmlos klingen, weil sie es sich nicht vorstellen können, was das konkret bedeutet. Ferner wäre auch die Verpflichtung zur Interoperabilität für bestimmte Dienste ein Beitrag zu mehr Verbraucherschutz. Oftmals ist man auf die Nutzung von WhatsApp als Messenger angewiesen, weil sich dort die meisten Gruppen des sozialen Lebens organisiert haben. Von der Elterngruppe über den Turnverein bis hin zur freiwilligen Feuerwehr. Möchte man partizipieren, so führt kein Weg an diesem Datenfresser vorbei. Eine vorgeschriebene Interoperabilität würde es ermöglichen, auch mit anderen Apps auf die Gruppen zugreifen. Problematisch hieran ist jedoch, dass es nicht von Bayern geregelt werden kann, sondern eher in die Zuständigkeit der EU fällt. Auch müsste man sich auf Protokolle einigen, welche dann für den Austausch der Daten genutzt werden können.
III. Chancen und Herausforderungen
Ein gut umgesetzter Verbraucherschutz ermöglicht einen fairen Wettbewerb zwischen verschiedenen Anbietern und eröffnet die Möglichkeit, dass auch neue Anbieter eine Chance auf dem Markt bekommen. Dabei muss man jedoch aufpassen, an welchen Stellschrauben man dreht. Durch zu strenge Regeln etwa beim Datenschutz, könnte sich der Effekt umkehren und eine Barriere bei der Schaffung neuer Dienste als Alternative zu den großen Digitalkonzernen darstellen. Allein mit Aufklärung der Verbraucher kann man den Verbraucherschutz aber nicht wirklich verbessern, denn Interessierte können sich schon heute im Internet informieren und setzen Produkte von Konkurrenten großer Konzerne ein. Die breite Masse hingegen wird sich kaum die Zeit nehmen, sich nach anderen Lösungen umzusehen, wenn die Bedienung ihrer gewohnten Dienste doch so bequem ist. Auch Vorschriften über das verpflichtende Anbieten von Alternativen, so dass der Verbraucher selbst wählen kann, dürfen nur sehr überlegt eingesetzt werden. Nur wenn die Schüler bereits früh mit verschiedenen Systemen in Kontakt kommen, haben sie eine Entscheidungsgrundlage für die Wahl der Produkte die sie einsetzen möchten. Wie oben aufgezeigt, wird man in den Schulen bisher zumeist an die Standard-Produkte der bekannten Monopolisten herangeführt. Nicht zu unterschätzen ist der Gruppenzwang, wenn es z.B. darum geht, welchen Messenger man benutzt oder zu welchen sozialen Netzwerken man sich anmeldet. Wegen der eingeschränkten Gesetzgebungskompetenz der Länder in diesem Feld, wird es für einen echten verbesserten Verbraucherschutz eher ein Gesetz auf Bundesebene brauchen, vielleicht sogar auf EU-Ebene, damit die Regeln auch in der Praxis umsetzbar werden, ähnlich wie es beim Datenschutz durch die Einführung der DSGVO der Fall war. Dies würde aber Jahre bis zum Inkrafttreten dauern. Bei einer erfolgreichen Umsetzung von digitalem Verbraucherschutz und Stärkung der Medienkompetenz in der Bevölkerung ergibt sich die Chance, die Monopole der Digitalkonzerne zumindest auf dem lokalen Markt zu schwächen und so mehr Wettbewerb zu ermöglichen. Auch wird durch eine Verteilung der Macht verhindert, dass einzelne Marktteilnehmer überwiegenden Einfluss auf die Gesetzgebung oder über die Information der Bevölkerung sogar auf Wahlergebnisse hat. Herausfordernd wird es jedenfalls sein, die breite Masse der Bevölkerung zu erreichen, weil es auf den ersten Blick keinen Anreiz für eine Fortbildung in diesem Bereich gibt, denn man hat ja schon eine funktionierende, bekannte und bequeme Lösung.
IV. Fazit und Bewertung
Von „digitalem Verbraucherschutz“ zu sprechen kann gefährlich sein, vor allem weil das Gesetz überwiegend die Stärkung der Kompetenzen der Verbraucher meint und nicht den Verbraucherschutz als solchen direkt. Das BayDiG enthält keine weitergehenden Schutzvorschriften für Verbraucher, welche sie gegen Unternehmen geltend machen können. Man könnte also vermuten, dass die Verantwortung von den Unternehmen zu den Verbrauchern verlagert werden soll. Schwierig ist zudem die Differenzierung zwischen digitalen und klassischen Unternehmen bzw. Geschäftsmodellen sein. Es stellt sich möglicherweise auch die Frage nach der Kompetenz zur Regulierung. Für Unternehmen könnte es sehr schwierig werden, wenn in jeden Bundesland andere Maßstäbe an den Verbraucherschutz gestellt werden. Folglich müsste Bayern sich auf Bundesebene für eine Stärkung des Verbraucherschutzes einsetzen. Informationskampagnen zur Stärkung der Kompetenz würden sich außerdem leicht skalieren lassen und müssten nicht von jedem Bundesland eigens in Auftrag gegeben werden. Gesetzgeberisch kann der Freistaat aktiv werden, indem man in den Schulen den Einsatz verschiedener (freier) Software mit aufnimmt und auch die alltägliche technische Ausstattung der Schulen mit freier Software umsetzt, was zugleich die digitale Souveränität fördert und damit gleich zwei Ziele des BayDiG gleichzeitig unterstützt. Insgesamt ist das Ziel trotzdem als positiv zu bewerten, denn kann bei richtiger Umsetzung die ungeschriebenen Grundrechte auf informationelle Selbstbestimmung und das Recht auf Vertraulichkeit und Integrität informationstechnischer Systeme („IT-Grundrecht“) in der Praxis genauer ausgestalten. Bisher wissen viele Bürger noch nicht einmal, dass sie diese Grundrechte innehaben. Folglich könnte Bayern über den Bundesrat eine Initiative zur Änderung des Grundgesetzes beginnen, um diese ungeschriebenen Grundrecht dort aufzunehmen, damit sie besser in das Bewusstsein der Allgemeinheit rücken. Insgesamt gibt es bei diesem Ziel eine große Schnittmenge mit dem Ziel aus Art. 10 II BayDiG.